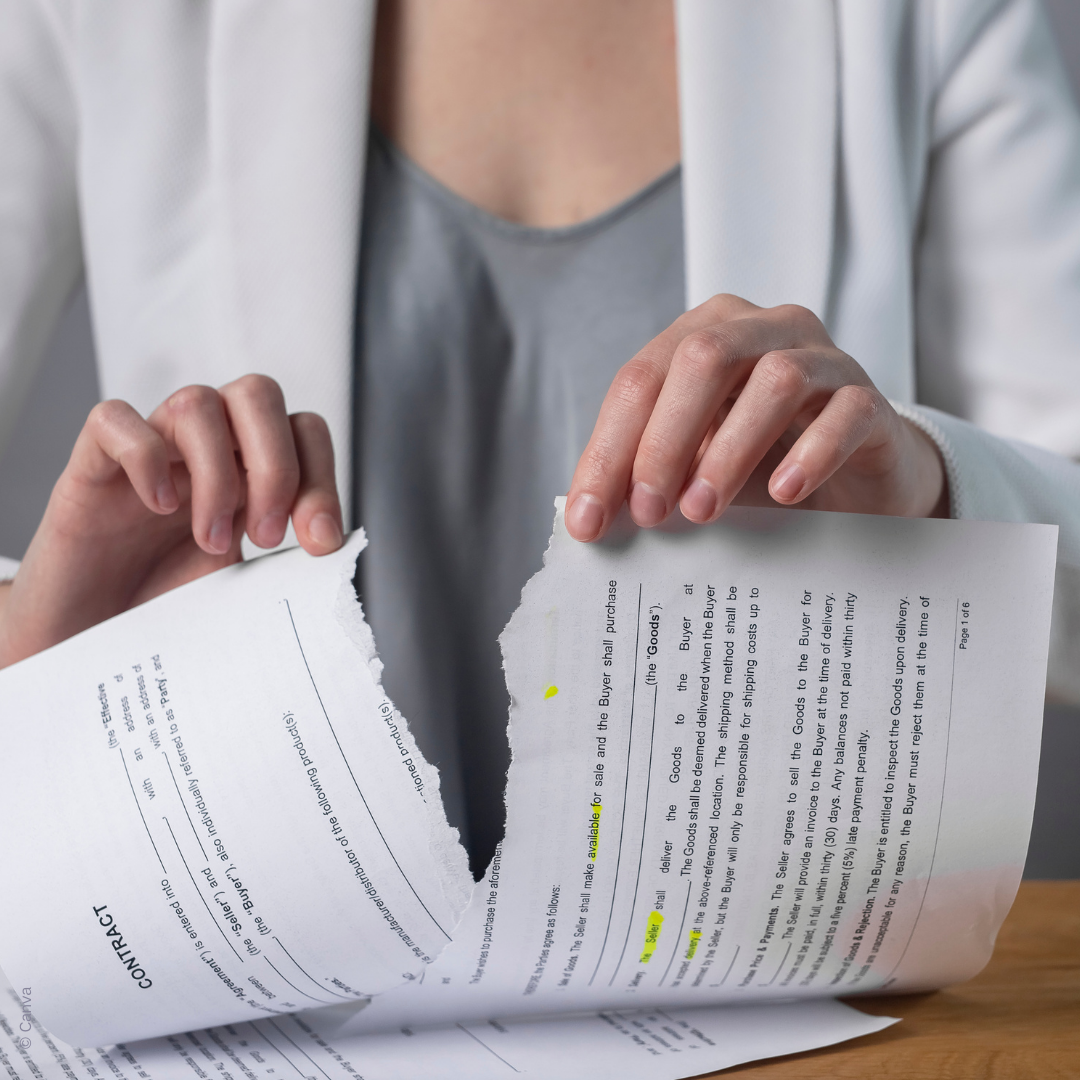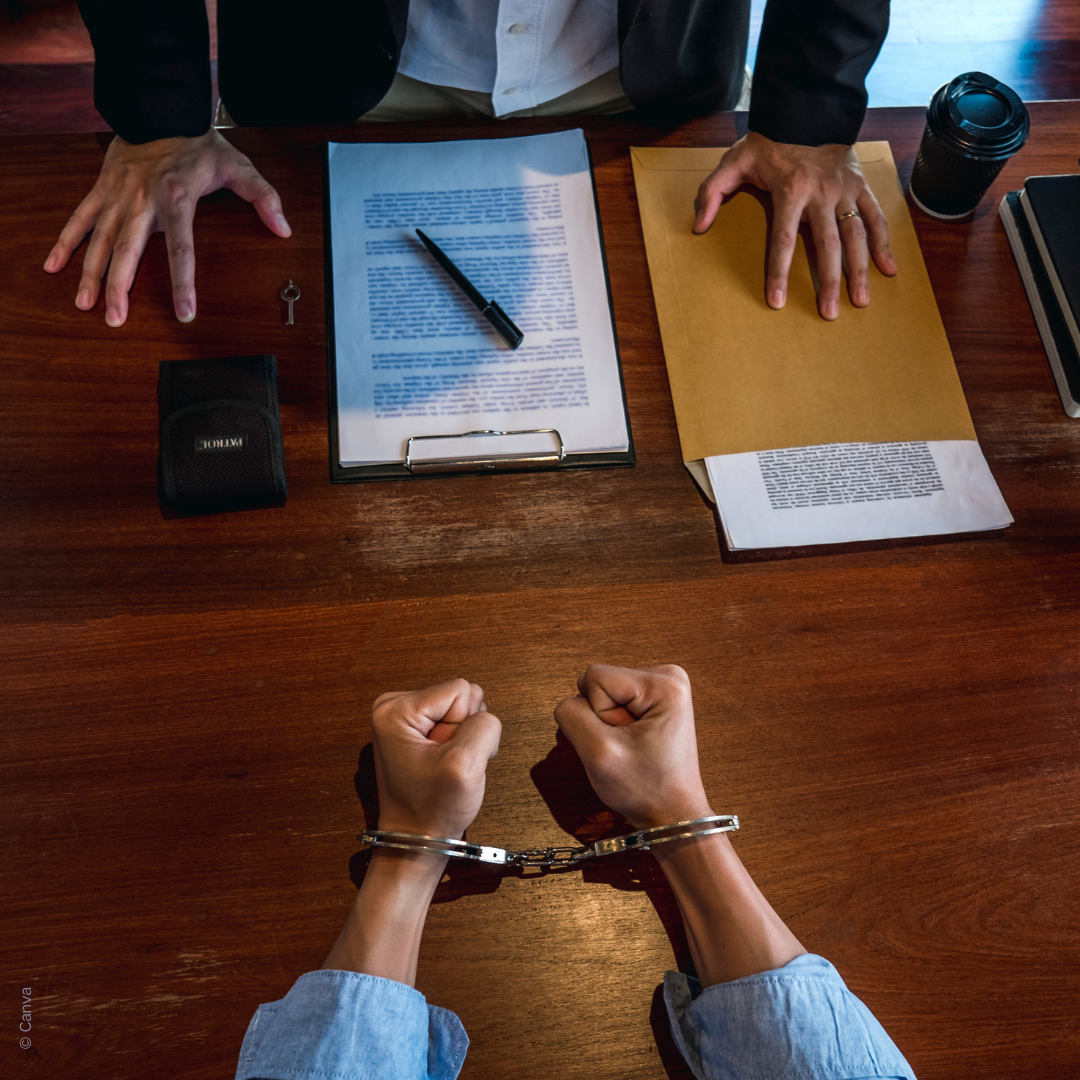Die Kosten eines familienrechtlichen Verfahrens stellen viele Betroffene vor erhebliche finanzielle Herausforderungen. Besonders bei Scheidungen oder Unterhaltsstreitigkeiten können hohe Gerichts- und Anwaltskosten entstehen. Doch bevor staatliche Verfahrenskostenhilfe (VKH) beantragt wird, sollte geprüft werden, ob ein Anspruch auf einen Verfahrenskostenvorschuss (VKV) besteht.
Der Verfahrenskostenvorschuss verpflichtet bestimmte nahestehende Personen – in der Regel den Ehepartner – dazu, die Kosten für ein familienrechtliches Verfahren zu übernehmen. Doch wann genau besteht dieser Anspruch, wie wird er geltend gemacht, und was ist bei der Antragstellung zu beachten? In diesem umfassenden Ratgeber erfährst du alles Wichtige zu diesem Thema.
Unterschied zwischen Verfahrenskostenhilfe und Verfahrenskostenvorschuss
Viele Menschen verwechseln die Begriffe Verfahrenskostenhilfe (VKH) und Verfahrenskostenvorschuss (VKV). Beide dienen dazu, finanzielle Belastungen durch Gerichtsverfahren abzumildern, unterscheiden sich aber in wesentlichen Punkten:
Verfahrenskostenhilfe (VKH): Staatliche Unterstützung für Personen, die sich ein Gerichtsverfahren finanziell nicht leisten können. Sie wird nur gewährt, wenn kein Anspruch auf einen Verfahrenskostenvorschuss besteht.
Verfahrenskostenvorschuss (VKV): Verpflichtet nahe Angehörige, insbesondere Ehepartner, dazu, die Verfahrenskosten vorzuschießen. Dies gilt insbesondere im Scheidungs- und Unterhaltsrecht.
Wichtig: Erst wenn nachgewiesen wurde, dass kein Anspruch auf VKV besteht, kann eine Verfahrenskostenhilfe bewilligt werden.
Wer hat Anspruch auf Verfahrenskostenvorschuss?
Ein Verfahrenskostenvorschuss kann von folgenden Personen beansprucht werden:
- Ehegatten oder getrennt lebende Ehepartner (solange die Scheidung nicht rechtskräftig ist)
- Kinder (gegenüber ihren unterhaltspflichtigen Eltern)
- Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft
Gesetzliche Grundlage: § 1360a Abs. 4 BGB
Laut § 1360a Abs. 4 BGB sind Ehegatten verpflichtet, einander Unterhalt zu leisten. Dieser Unterhalt umfasst auch die finanziellen Mittel, um in einer persönlichen Angelegenheit ein Gerichtsverfahren zu führen. Das bedeutet, dass der finanziell besser gestellte Ehepartner die Kosten für den anderen übernehmen muss, sofern dieser dazu nicht in der Lage ist.
Voraussetzungen für den Verfahrenskostenvorschuss
Damit ein Anspruch auf VKV besteht, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
- Bedürftigkeit
Die antragstellende Person muss finanziell außerstande sein, die Verfahrenskosten selbst zu tragen. Das bedeutet:
- Kein ausreichendes Einkommen oder Vermögen zur Deckung der Verfahrenskosten
Falls Vermögen vorhanden ist, muss es soweit verwertet werden, wie es zumutbar ist
- Persönliche Angelegenheit
Das Verfahren muss eine persönliche Angelegenheit betreffen. Dazu zählen:
- Scheidungsverfahren
- Unterhaltsverfahren (z. B. Kindesunterhalt, Trennungsunterhalt)
- Sorgerechts- und Umgangsrechtsstreitigkeiten
Nicht umfasst sind wirtschaftliche Auseinandersetzungen, etwa in Gesellschafts- oder Steuerangelegenheiten.
- Leistungsfähigkeit des Zahlungspflichtigen
Der Ehegatte oder Elternteil, der zur Zahlung des Verfahrenskostenvorschusses verpflichtet ist, muss finanziell in der Lage sein, die Kosten zu übernehmen. Dabei wird das bereinigte Nettoeinkommen betrachtet.
Ist der Ehepartner nicht zahlungsfähig, besteht kein Anspruch auf VKV.
Falls er nur eingeschränkt zahlungsfähig ist, kann auch eine Ratenzahlung verlangt werden.
- Billigkeitsprüfung
Die Forderung nach einem Verfahrenskostenvorschuss muss angemessen und nicht mutwillig sein.
Der angestrebte Rechtsstreit muss Aussicht auf Erfolg haben.
Es darf keine mutwillige Rechtsverfolgung sein.
Antragstellung und Verfahren
Der VKV wird durch eine einstweilige Anordnung beim zuständigen Familiengericht beantragt. Ein solcher Antrag könnte lauten:
„Der Antragsgegner wird verpflichtet, an die Antragstellerin einen Verfahrenskostenvorschuss in Höhe von … € nebst Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz zu zahlen. Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsgegner.“
Zuständiges Gericht
Falls eine Ehesache anhängig ist: Zuständiges Familiengericht der Ehesache
Falls keine Ehesache anhängig ist: Gericht des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes oder des Antragstellers
Nachweise
Eidesstattliche Versicherung über die Bedürftigkeit
Einkommens- und Vermögensnachweise beider Ehepartner
Aufschlüsselung der zu erwartenden Verfahrenskosten
Entscheidung
Das Gericht entscheidet durch Beschluss (§ 38 Abs. 1 S. 1 FamFG)
Eine mündliche Verhandlung ist nur erforderlich, wenn sie zur Sachverhaltsaufklärung nötig ist
Die Entscheidung ist nicht anfechtbar
Berechnung des Verfahrenskostenvorschusses
Die Höhe des Vorschusses orientiert sich an den erwarteten Verfahrenskosten:
- 1,3 Verfahrensgebühr
- 1,2 Terminsgebühr
- Auslagen und Umsatzsteuer
- 2,0 Gerichtsgebühr
Ist der Verfahrenskostenvorschuss zurückzuzahlen?
Da der VKV als Unterhaltsleistung gilt, ist er grundsätzlich nicht zurückzuzahlen.
Eine Rückforderung ist nur möglich, wenn sich die finanziellen Verhältnisse des Antragstellers erheblich verbessern.
Fazit
Der Verfahrenskostenvorschuss ist ein wichtiges Instrument, um Personen, die sich ein familienrechtliches Verfahren nicht leisten können, finanziell zu entlasten. Er ist vorrangig vor der staatlichen Verfahrenskostenhilfe zu prüfen. Die Antragstellung muss gut vorbereitet sein, um eine Ablehnung zu vermeiden.
Tipp: Eine einvernehmliche Scheidung reduziert die Kosten und kann die Durchsetzung eines VKV erleichtern. Wer sich unsicher ist, sollte frühzeitig rechtlichen Rat einholen.
©Karola Rosenberg